
Die Gräber von Jacquin pere et fils
Englische Gaerten in Wien und Umgebung
Am Beispiel des Laxenburg - Parks und des Botanischen
Gartens in Wien.
© Franz Krahberger
Eine Hommage an Stefan Endlicher
Entwurf des Garten & Park Media Projektes

Die Gräber von Jacquin pere et fils
Mehr oder minder zufällige Spaziergänge durch den Landschaftsgarten von
Laxenburg machten mich für die Idee und die Gestalt des Parks
empfänglich. So begann ich mich nach ausgedehnten und gezielt gelenkten
Spaziergängen für die “verborgene Struktur“ des Parks zu
interessieren.
Die Gärten wurden offensichtlich zum Zweck und mit der Absicht
angelegt, Natur in harmonischer Vielfalt dem Betrachter, dem Wanderer
darzubieten.
Die scheinbare Wildheit des englischen Landschaftsgartens ist Ergebnis
überlegten und durchdachten, sowohl gärtnerischen wie auch
künstlerischen Handelns.
Einer meiner ersten bewußten Eindrücke war, daß es ich es hier mit der
Darstellung einer Kosmogonie zu tun hatte, die sich des natürlichen
Anscheins bedient, um auf tiefer oder weiter liegendes und reichendes
hinzuweisen.
Auffällig war, daß der Landschaftsgarten oberflächlich so gar nichts mit
den domestizierten Gärten der Renaissance und des Barock zu tun hat.
Ich muß jedoch hinzufügen, daß mich gerade die Beschäftigung mit den
Gedankengängen der Renaissance für die Realität des Landschaftsgarten
vorbereitet hat.
Diese Form des Parks verfolgt die Intention, Kunst und Natur in
harmonischer Weise miteinander zu vereinen, ohne dies auf den ersten
Blick offensichtlich werden zu lassen. Das Ziel dieser Intention ist der
Betrachter, der Spaziergänger, der Schwärmer.
Der Landschaftsgarten ist also nicht als Reservat der Natur, des
Natürlichen zu betrachten. Er entspricht auch nicht der
Paradiesvorstellung. Er sensibilisiert den Blick und damit des Wesen des
Betrachters. Er verwirklicht im weitgehenden Sinn Ästhetik in ihrem
ursprünglichen Sinn als verfeinerte Wahrnehmung. Er erfüllt ein
durchdachtes Kalkül und meidet dabei die Plumpheit der Domestizierung
der Natur durch geometrische Formen.
Er macht die Liebe zur allumfassenden Natur deutlich, gewissermassen ein
naturschwaermerisches wie romantisches Projekt.. Winckelmann nennt
weiters Sentimentalität, Melancholie und historisches Bewußtsein als
menschliche Empfindungen und Erkenntnis, die in die Idee des Natur-Parks
verwoben sind.
Und tatsächlich, der Laxenburger Park hat, wenn man ihn über die
Jahreszeiten hinweg ergeht, mehrere Gesichter. Helle, lichte und
düstere und er ist niemals wirklich leicht.
Zur kalkulierten visuellen Übertragung gesellt sich die Bewegung. Die
“verborgene Struktur“ des Parks eröffnet sich erst dem Geher. Das
umfassende Kunstwerk bildet sich also erst in jenem heraus, der sich der
Mühe des Umganges unterzieht.
Godehard von Hoensbruch schreibt anlässlich der Revitalisierung des Parks von Schloß Türnich:
Die Idee des Landschaftsparkes zielt darauf, im Betrachter
Stimmungen und Stimmungsbilder durch wechselnde, aber harmonische
Abfolge möglichst naturnaher Situationen zu wecken. Diesem Ziele dienen
gleichermaßen Bäume, Sträucher, Stauden, Gräser und Pilze, aber auch die
Vielzahl der Insekten und Vögel und schließlich die unterschiedlichen
Wiesen, in die das Licht einfällt. Nur eine Komposition aus allen
Elementen kann die erwünschte Stimmung charakteristischer
Natursituationen hervorrufen. Ein richtig verstandener Landschaftspark
ist also per se ein ausgezeichnetes, weil vielfältiges Biotop. Hierzu
gehört auch das Werden und Vergehen, und zwar nicht in der Abfolge der
Jahreszeiten, sondern auch im Wachsen und Sterben und vor allem im
Umsetzen des Gestorbenen in neues Leben. deshalb wird Laub und Holz
liegengelassen und tote Bäume nur dann gefällt, wenn dies aus Gründen
der Sicherheit geboten ist. Geschnittener Rasen gehört nicht in den
Landschaftspark. Nur Wildwiesen und die Mannigfaltigkeit der
Staudenflora in den halbschattigen Bereichen vermitteln uns ein Bild vom
Reichtum der Natur.
In dieser Beschreibung erkennen wir ähnliche und weitere Aspekte des
Laxenburger Parks. Es ist so, das Parks, die dieser bestimmten
Geisteshaltung entsprechen, quer durch Europa errichtet wurden. Géza
Hajós nennt sie die romantischen Gärten der Aufklärung.
Hoensbruch meint weiters, daß das Idealbild einer Landschaft in diesen
Parks umgesetzt wird. Doch dieses Idealbild einer Landschaft zielt auf
die Seele des Betrachters. Es sind also in Wahrheit Seelenlandschaften,
Übertragungen von Ideen.
Sie entsprechen wieder unserem heutigen Zeitgefühl. Nur hat die
innewohnende Mahnung an die Vergänglichkeit ein fast erdrückendes
Gewicht gewonnen. Denn nicht nur der individuelle Betrachter wird aus
der Welt verschwinden, und das war den Aufklärern sehr klar, sondern
die Natur selbst ist kaum zweihundert Jahre nach dieser Gartenbewegung,
diesem Versuch des Zurücks zur Natur, in Auflösung begriffen.
Zur Melancholie und zur Sentimentalität des einzelnen, der nach seiner
abgelaufenen Zeit das Paradies des Lebens verlassen muß, gesellt sich
die Angst vor dem unwiederruflichen Tod der Natur selbst.
Eine Besonderheit englischer Gartenlandschaft stellt der Hortus Botanicus Viennensis,
der Wiener botanische Garten, wie er von Stefan Endlicher zu Mitte des 19. Jahrhunderts
in Folge der barock strengen Gartenanlage von Nikolaus von Jacquin und dessen Sohn Joseph
errichtet worden ist.
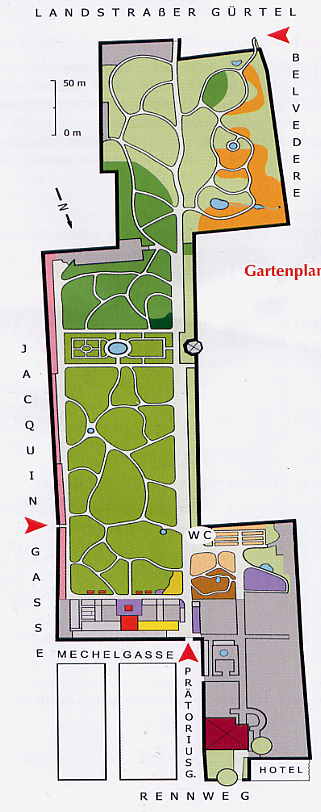
Überblick
Begründet wurde der Hortus Botanicus von Ihro Majestät Maria Theresia
auf Anraten ihres Leibarztes Gérard van Swieten 1754 und diente den
Studenten der Medizin, der Pharmazie und der neu begründeten Botanik und
Chemie zu anschaulichen wie praktischen Studien.
Nikolaus Jacquin (1727 - 1817) errichtete die ersten Gewächshäuser, erweiterte die
Freilandsammlungen und ordnete den Content nach dem Linnéschen System. Sein
Sohn und Nachfolger vergrösserte und erweiterte die Anlage in Beibehaltung der
Struktur.
Dessen Nachfolger, Stefan Ladislaus Endlicher (1804 - 1849) entwickelte eine Genera Plantarum, kurz zusammengefasst
in seinem Enchiridion Botanicum exhibens classes et ordines plantarum
accedit nomenclatur generum et officinalium vel usualium indicatio.
auctore Stephano Endlicher, M.D. botanicus in facultate medica vindobonensi
Prof.P.O., erschienen 1841 in Wien.
Endlichers dicht gepacktes Gartenmuseum mit mehr als 8500 Pflanzenarten
geht in der geistigen Konzeption über den noch symbolisch befrachteten
englischen Garten am Beispiel Laxenburgs, vergleichbar der Fürst Pückler
Muskauischen Gartenanlage in Preussen, heute an der deutsch polnischen
Grenze in Ost-Brandenburg gelegen, radikal hinaus.
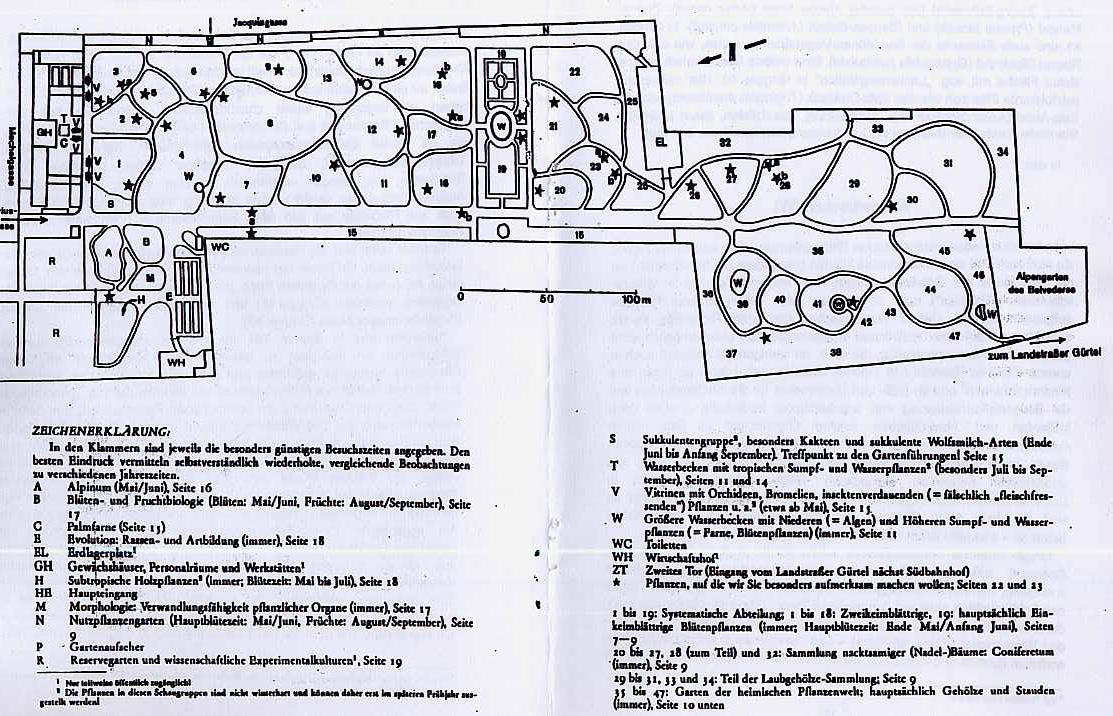
Abteilungen
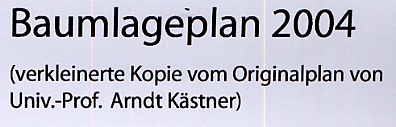

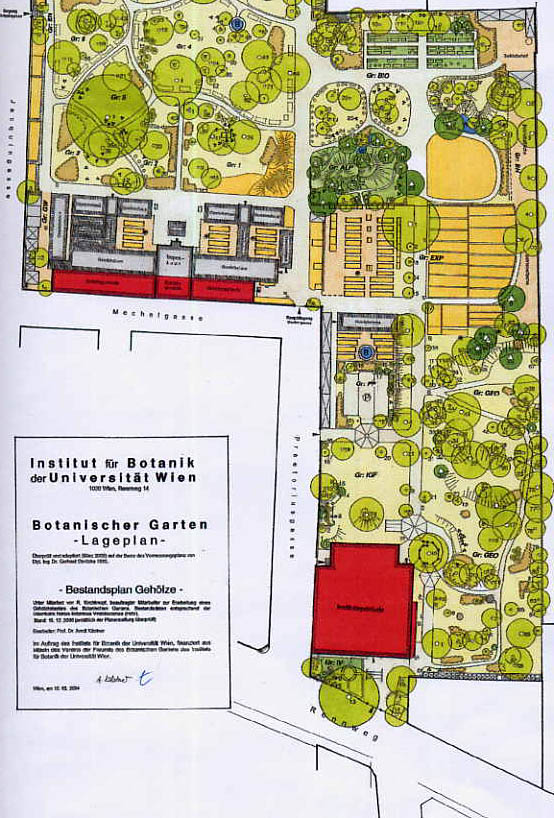
Endlichers Garten ist befreit von philosophischen Lasten wie innerten Signaturen der Herrschaft.
Es ist der Natur- Garten par excellence und atmet die Freiheit wie die Kenntnis
der Naturwissenschaften. Die Ästhetik des Gartens folgt nicht mehr
formalen, im platonischen Sinne strukturierenden Verhältnissen sondern bildet
die Vielfalt der Natur und der Pflanzenarten ab, in dem diese real präsentiert
werden und ihren Reiz aus der ihnen selbst innewohnenden Schönheit der Natur
abgewinnt.

Bambuslandschaft

Überblick
Wege und Inseln sind so angelegt, dass sich an deren strukturellen Rhizomatik
die verschiedensten Untergruppen vernetzen können. Sie konkurrienen einander,
sie ergänzen sich in einer flexibel angelegten unitas pluralis.
Sowohl Endlichers Ordnungssystem wie auch seine Repräsentationsform sind
radikal modern und auch als solches noch immer spürbar.
Betritt man den botanischen Garten, wird man keineswegs in den Formenkanon
vergangener Epochen, wie etwa im parallel gelegenen Belvedere Park versetzt,
sondern erfährt und erwirbt die aktuelle Gegenständlichkeit der Natur.
In Stefan Endlichers Garten befindet man sich sozusagen in der Realzeit der
Natur, durchaus vergleichbar der Alexander von Humboldtschen Kosmologie,
die sich von der menschlichen Kosmogonie und von der strikten Regulierung
falsch verstandener religiöser Ordnung, die in Wahrheit blosse menschliche
Machtwillkür wider spiegelte, endlich befreit hat.
Stefan Endlichers Garten ist nicht Garten der Aufklärung im Sinne der Education
mittels Herausbildung zeigender symbolischer Formen, wie sie noch
in Johann Wolfgang Goethes Pädagogischer Provinz in Wilhelm
Meisters Wanderjahren repräsent sind, sondern stellt eben das
letztendliche Ziel der Aufklärung, die kreative Wechselwirkung von Natur
und menschlicher Gestaltungskraft an sich dar. Es ist der Garten
an sich, für sich und für uns.
Die Familie Endlichers ist aus Bayern in die Monarchie zugewandert.
Nach Studien in Budapest und Wien empfing Endlicher die niederen
Weihen, verliess jedoch 1826 die geistliche Laufbahnund wurde
1828 in der Wiener Hofbibliothek angestellt, wo er eine Abfassung
eines Kataloges der Handschriften übernahm.
In der Folge beschäftigte er sich intensivierend mit botanischen Studien
und wurde 1836 Kustos am Hofnaturalienkabinett, das ihm als
erstes wissenschaftliches Institut eine eigene Zeitschrift verdankt.
Dem 1839 zum Professor der Botanik ernannten wurde 1840 unter
Nachlass der Prüfungen der medizinische Doktorgrad verliehen.
Der Direktor des Botanischen Gartens erwarb er sich grosse Verdienste
um dessen Neugestaltung und um die Errichtung eines Museumsgebaeudes.
Obwohl Endlicher die Gunst Kaiser Ferdinands genoss, dem er durch
Jahre regelmässig naturwissenschaftliche Vorträge hielt, wandte er sich
1848 der freiheitlichen Bewegung zu, zeitweilig als Kommandant des
akademischen Militär Korps und wurde in das Vorparlament von
Frankfurt und in den Reichstag von Kremsier gewählt.
Mässigungsversuche machten ihn bei den Studenten unbeliebt, eine Denunziation
als Hochverräter bei der Regierung zwang ihn zur Flucht. Endlicher war
zwischen die Fronten geraten.
Endlichers wissenschaftliche Arbeiten umfassen zusätzliche klassische,
deutsche und chinesische Philologie., Numismatik und Rechtsgeschichte.
Seinen Ruhm begründete er jedoch als Botaniker, vor allem durch seine
Genera plantarum, die bis zu J.D.Hooker und G.Benthams gleichnamigen
Werk die umfassendste Darstellung des Pflanzenreichs in einem
natürlichen, allerdings noch Konstanz der Arten voraussetzenden
System bildeten.
Im Gegensatz zu der wenig erfolgreichen Haupteinteilung steht die
ausgezeichnete Charakteristik der Gattungen und Familien, die ihm
weiteste Anerkennung verschaffte.
Die mit F.Unger herausgegebenen „Grundzuege der Botanik“ (1843)
bringen - eine Idee Endlichers - erstmalig Textillustrationen.
Für die Botanik Österreichs bedeutete das Wirken dieser beiden
Gelehrten eine neue Blütezeit nach einer Periode vorübergehenden
Stillstands.
Mitglied der Akademie der Wissenschaften Wien, an deren
Gründung Endlicher entscheidend beteiligt war.
1848 trat er jedoch nach einem Konflikt mit Hammer Purgstall
wieder aus.
Friedensklasse des Pour le mérite
Nach dem Tod von Jacquin II übernahm Stefan Endlicher
das Ordinariat für Botanik und die Gartendirektion.
In Ausführung seiner Vorstellungen eines „Natürlichen
Systems“, wie er es in „Generum Plantarum“ publiziert hatte,
wurde 1841 mit der völligen Neugestaltung des Gartens
begonnen.
Auf der Fläche des alten Gartens wurde eine offizielle
Abteilung mit 196 Beeten angelegt und an der Südseite das
botanische Museum eingerichtet. Endlicher pflanzte 8166
Arten.
1849 wurde Eduard Fenzl (1808 - 1879) der mit Endlicher
zusammen gearbeitet hat, Gartendirektor.
Er setzte die Neugestaltung des Gartens im Sinne Stefan
Endlichers mit Hilfe des Obergärtners Josef Dieffenbach
endgültig durch.
Darstellung der Endlicher Konzeption vorerst in grossen Zügen.

Der kleine Alpengarten
Im Detail sollen vor allem der kleine und der grosse Alpengarten,
das Pannonicum und die Reproduktion der Rax-Fauna gezeigt werden, um
im weiteren Bezüge zu den realen österreichischen Naturlandschaften
herzustellen.


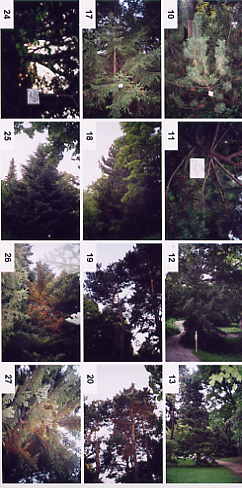
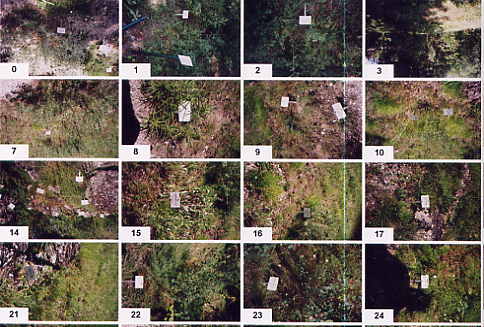
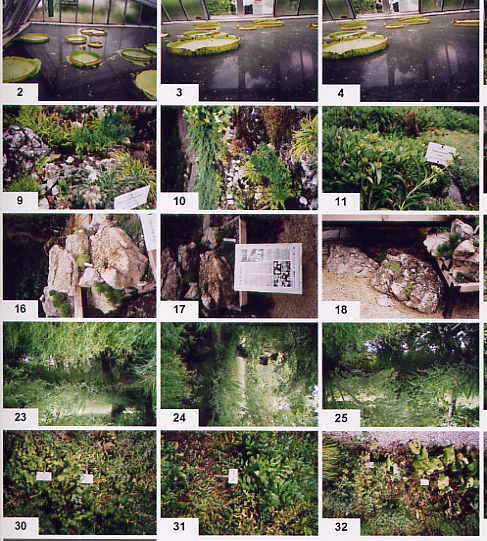
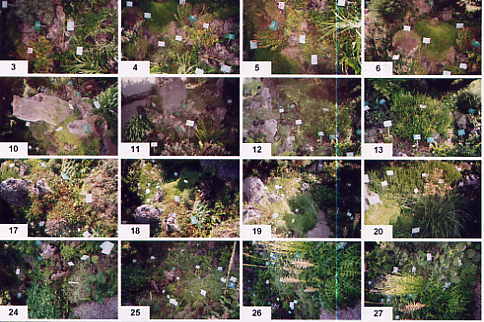
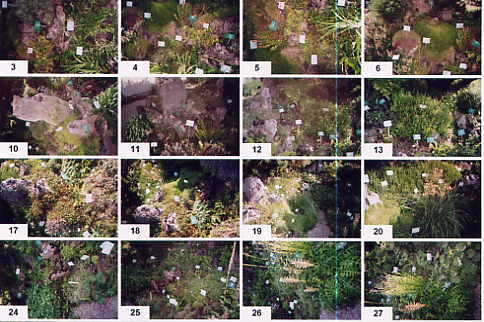

Offizielle Website des Botanischen Gartens der
Universität Wien
Der Bildhauer Wilhelm Beyer, der an der Gestaltung des Laxenburger
Parks mitgewirkt hat, schreibt in seiner Abhandlung über den
Landschafstgarten, in der er auch sein bildhauerisches Angebot
ausbreitet, also Bacchanten, Floren, Grazien, Satyrn und Pan, Apolls und
Dianen mit ihren Nymphen, Nayaden, Leda, Schwäne und murmelnde Bäche,
“Das Wasser ist die Seele des Erdbodens“.

Diesen Satz möchte ich zu einem Schlüsselsatz des Laxenburgprojektes
machen. Denn gerade das den Park durchpulsende Wasser des an die
Triesting gebundenen Zubringerkanals ist extrem bedroht, seit Jahren
durch Abwasser verschmutzt, durch chemische Einbringungen aus der
Landwirtschaft überdüngt und knapp an der Kippe. Entsprechend ist die
Situation des Wassers in der Parklandschaft.
Hin und wieder merkbar, riechbar und betrüblich schlecht.
Die Situation des Wassers als Teil des Gesamtkunstwerkes Park betrifft
natürlich symbolisch im weiteren unsere Umwelt, unsere Lebensqualität.
Das Laxenburgprojekte zielt nicht ab auf einen beliebigen
künstlerischen Spektakel, in dem Zelte aufgeschlagen und wieder
abgebrochen werden.
Es soll über die kulturelle Botschaft hinaus zur Sensibiliserung in
wesentlichen Überlebensfrage beitragen und eine Initiative zur
Revitalisierung der Naturlandschaft und der Reinigung und Reinhaltung
der natürlichen Fliess-Gewässer sein.
6/9/2004:
Wir sind heute in Laxenburg gewesen. Der Park hat offenbar fürs erste die nun fünf Jahre zurückliegende
Krise bedingt durch die Wasserverschmutzung überwunden und verarbeitet. Wie
weit eine veränderte Bewirtschaftung dazu beigetragen hat, werde ich in Erfahrung bringen.
Mitarbeiter des Franzensburg Museums haben die gefährlich an der Kippe stehende Krise der Parklandschaft
in guter Erinnerung und wissen um die Gefahren Bescheid.
Im Oktober 2001 wurde in Auftrag des Bundesdenkmalamtes ein Parkpflegewerk unter Leitung
von Prof . Franz Bódi das Parkpflegewerk begonnen und der Forstmeisterkanal endlich
von den Schlammrückständen, in denen sich wesentlich die Gewässerverschmutzungen ablagern,
befreit und entlastet.
Die Zubringergewaesser sind jedoch nach wie vor in einem bedenklichen
Zustand. Die Krise der Laxenburger Naturanlage kann jederzeit wieder
eintreten. Ein rigides allgemeines Wassersanierungskonzept ist nach wie
vor zu empfehlen und würde auch den Anwohnern der Triesting, der
Schwechat und des Wassereinzugsgebietes der Niederösterreichischen
Industrieviertels zugute kommen.
Sowohl in Kärnten wie auch in der Steiermark sind derartige Projekte
gelungen und haben sich als machbar erwiesen und langfristig
bewährt.
Denkt an die Zukunft der Welt !

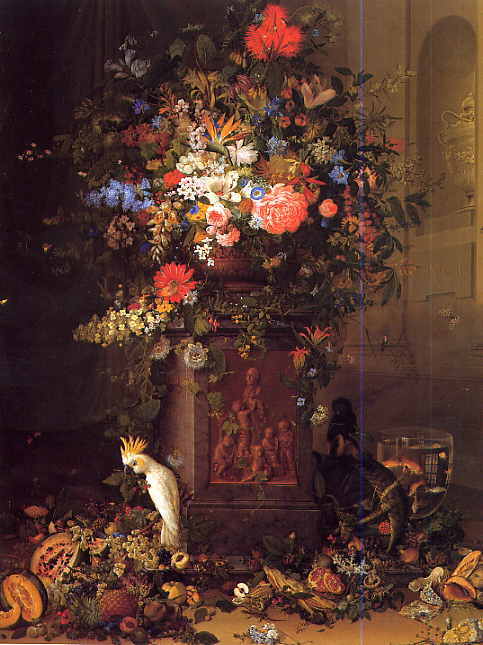
Jacquins Denkmal
Ein Huldigungsbild von Johannes Knapp, 1822
Aktuelle Garten- und Landschaftsarchitektur
Shunmyo Masuno; Japan Landscape Consultants
Antonio Perazzi; studio de aeseaggio
Taylor Cullity Lethlean; Melbourne